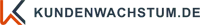Das Thema „Künstliche Intelligenz“, kurz auch als „KI“ bezeichnet, ist aktuell in aller Munde. Die Bereiche Deep Learning und Machine Learning sind dabei besonders wichtig. In der Wirtschaft erhoffen sich Unternehmen effektivere Prozesse durch den Einsatz von intelligenten Algorithmen und künstlichen Systemen. Daher wird in der Wirtschaft 4.0 massiv in diesem Bereich geforscht und immer mehr Ergebnisse bzw. Produkte haben ihren Platz in das alltägliche Leben gefunden.
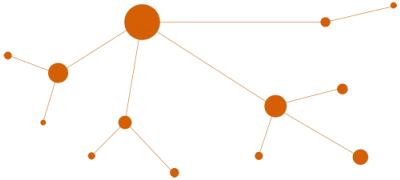
Deep Learning und Machine Learning
Als eine neue Technologie bietet die künstliche Intelligenz viele spannende Möglichkeiten und Chancen. In diesem Beitrag gehen wir näher auf die verschiedenen Fachbegriffe ein und erklären, wie uns Machine Learning zukünftig unterstützen wird.
Das findest Du auf dieser Seite
- Bedeutung von Künstlicher Intelligenz, Deep Learning, Machine Learning
- Was bedeutet Deep Learning?
- Künstliche Intelligenzen
- Wie funktioniert Deep Learning?
- Was ist der Unterschied zwischen maschinellem und Deep Learning?
- Besonderheit beim Deep Learning – Neuronale Netze
- Woraus bestehen künstliche neuronale Netze?
- Machine Learning – Definition
- Welche Arten von Maschinellem Lernen gibt es?
- Unterscheidung anhand der zur Verfügung gestellten Informationen
- AI für die perfekte Zielgruppenansprache im Marketing
- Personalisierte Treffer bei Search Engines und Spracherkennung
Bedeutung von Künstlicher Intelligenz, Deep Learning, Machine Learning
Nicht jeder verbindet mit Begriffen wie Deep Learning, Machine Learning, Artificial Intelligence (AI) oder Big Data etwas Positives. Allerdings lässt der aktuelle Trend vermuten, dass sich die künstliche Intelligenz langfristig durchsetzen wird und das Zeitmanagement wie wir es kennen verändern wird. Zu groß sind die Vorteile, die sich aus der Nutzung von Deep Learning und maschinellem Lernen ergeben. Es wird mit einer stetig besseren user Experience gerechnet, besonders junge Menschen sind diesem Know-how gegenüber offen und nutzen gern die Vorteile des technischen Fortschritts.
Diese ersten Modelle im Bereich Künstliche Intelligenz entstanden in den fünfziger Jahren. Die Idee war, dass man menschliche Lern- und Denkprozesse auf Maschinen bzw. Computer übertragen könnte. Diese Vision manifestiert sich in den letzten Jahren immer stärker. Heutige IT-Systeme sind mithilfe von AI in der Lage, effiziente Lösungen für viele Probleme zu finden und anzuwenden. Das Erstaunliche dabei ist, dass die Maschinen ohne menschliche Hilfe auskommen können.
Wer aufhört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen.
Henry Ford
Was bedeutet Deep Learning?
Der Begriff Deep Learning lässt sich am besten mit tiefgehendem Lernen übersetzen. Gemeint sind damit verschiedene Optimierungsmethoden, die bei künstlichen neuronalen Netzen in Benutzung sind und die hier auch eine innere Struktur besitzen. Die Besonderheit beim Deep Learning besteht darin, dass auch ein stabiler Lernerfolg gewährleistet ist, wenn es viele Zwischenablagen gibt.
Der Begriff Deep Learning wurde 2002 erstmals verwendet, als der deutsche Informatiker Jürgen Schmidhuber damit künstliche neuronale Netze definierte. Die Wurzeln des Deep Learning reichen jedoch sehr viel weiter zurück. So hatte der US-amerikanische Informatiker Frank Rosenblatt bereits 1958 erstmals künstliche neuronale Netzwerke vorgestellt, welche zur Gesichtserkennung verwendet wurden. Diese waren jedoch nicht lernfähig.
Künstliche Intelligenzen
Sie wurden damals verwendet, um Probleme zu lösen, die für den Menschen schwierig, von Computern aber einfach zu lösen waren. Dieser Prozess ist im dauerhaften Wandel und Unternehmen kämpfen durch die Optimierung, um die beste Positionierung am Markt.
Der Grund: Diese Probleme ließen sich mit Hilfe von mathematischen Formeln und Regeln beschreiben. Die besondere Herausforderung für Entwickler lag nun darin, auch Aufgaben, die sich durch mathematische Regeln nur schwer beschreiben ließen, von Computern lösen zu lassen. Der Mensch hingegen ist in der Lage dazu, diese Probleme intuitiv zu lösen.
Computer mussten also dazu in die Lage versetzt werden, aus Erfahrungen aus der Vergangenheit zu lernen. Dadurch ist es nicht mehr notwendig, dass der Mensch jene Informationen, die der Rechner braucht, zu spezifizieren und einzugeben. Der Computer soll also in der Lage dazu sein, basierend auf einfachen Konzepten auch komplizierte zu erlernen. Wird der Aufbau dieser Konzepte in Form eines Diagramms dargestellt, zeigen sich zahlreiche Schichten. Das ist auch der Grund dafür, warum dieser Ansatz als Deep Learning bezeichnet wird: Der Computer dringt in immer tiefere Schichten vor.
Bring Dein Online-Marketing 2024 ein Level weiter!
90 Minuten gratis Beratung
SEO
Optimierung
Nachhaltig mehr Reichweite und Sichtbarkeit in Deiner Zielgruppe erreichen!
Content
Marketing
Direkt, optimiert und zielgerichtet Inhalte Deiner Zielgruppe präsentieren!
Marketing
Automation
Erstklassige Benutzererlebnisse für höhere Kundenbindung und Conversion!
Wie funktioniert Deep Learning?
Rohe sensorische Daten wie etwa eine handschriftliche Notiz kann ein Computer nur sehr schwer erkennen. Der Grund dafür liegt darin, dass diese Texte zunächst lediglich eine Ansammlung von Bildpunkten darstellen, die sich dann im nächsten Schritt in Buchstaben und Ziffern überführen lassen. Der Computer muss also in die Lage versetzt werden, aus den eingegangenen Rohdaten ein komplexes Muster zu erstellen. Bei der manuellen Programmierung ist das ein schier unüberwindliches Hindernis.
Deshalb ist gern für die künstliche Intelligenz das maschinelle Lernen in Benutzung, deshalb nutzt Deep Learning für diesen Prozess eine Hierarchie von Konzepten. Dabei orientieren sich die dafür entwickelten künstlichen neuronalen Netze am Aufbau des menschlichen Gehirns, das heißt, die einzelnen Neuronen sind miteinander wie ein Netz verknüpft. In der ersten Schicht müssen die eingegebenen Rohdaten am Ende verarbeitet sein, bevor die Daten an die nächste Schicht zur weiteren Verarbeitung weitergehen. Bezeichnet werden diese einzelnen Schichten auch als versteckte Ebenen. Die Ausgabe des Ergebnisses erfolgt dann schließlich erst in der letzten Schicht. Die an sich komplizierte Verarbeitung der Daten wird dadurch in einzelne und überschaubare Zwischenschritte unterteilt.
Was ist der Unterschied zwischen maschinellem und Deep Learning?
Als Machine Learning werden verschiedene mathematische Methoden bezeichnet, mit deren Hilfe sich bestimmte Muster erkennen lassen. Computer erkennen diese Muster dadurch, dass die Daten in eine hierarchische Struktur, also in einen sogenannten Entscheidungsbaum, aufgteilt sind. Alternativ lassen sich Ähnlichkeiten in den Datensätzen auch über Vektoren ermitteln, sodass sich die Muster ganz automatisch erschließen.
Mittlerweile sind die dafür verwendeten Algorithmen sogar dazu in der Lage, nicht nur ganz alltägliche, sondern auch äußerst spezielle Probleme zu lösen. Vor Problemen stehen Entwickler lediglich, wenn das Datenmaterial zu dünn ist oder dieses in zu viele Dimensionen aufgeteilt ist. Der Grund dafür: Basieren die Algorithmen auf Vektorräumen stoßen sie durch zu viele Dimensionen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Lern-Algorithmen hingegen werden zu komplex, wenn sich die Daten in zu viele Dimensionen aufteilen. Weil diese dimensionalen Räume sehr groß sein können, sind die Algorithmen damit schlicht überfordert.

Mittels statistischer Methoden lässt sich die Zahl der Dimensionen aber so weit reduzieren, dass lediglich die nützlichsten relevant sind. Dieser Auswahlprozess wird auch als Feature Engineering bezeichnet. Die Auswahl der passenden Features nimmt auch den größten Teil der Arbeitszeit der Data Scientists in Anspruch.
Besonderheit beim Deep Learning – Neuronale Netze
Beim Deep Learning handelt es sich folglich nur um eine Unterdisziplin des maschinellen Lernens, bei welchem künstliche neuronale Netze in Einsatz kommen. Hierbei machen sich die Entwickler die Natur zum Vorbild, indem sie sich am Aufbau biologischer neuraler Netze orientieren. Die Neuronen der künstlichen Netzwerke werden dann dahingehend trainiert, dass sich durch ein bestimmtes Eingabemuster auch stets dasselbe Ausgabemuster ergibt.
Bei künstlichen neuronalen Netzwerken existiert der Vorteil, dass die Zusammenhänge zwischen den Daten der Eingabe und jenen der Ausgabe sehr stark abstrahieren lässt. Deshalb lässt Deep Learning auch genutzt, wenn sich mit Hilfe anderer maschineller Lernverfahren nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen lassen oder auch wenn kein eigenes Feature Engineering in Verwendung ist.


Online-Marketing sollte für die Zielgruppe so anziehend sein, dass diese das werbende Unternehmen unbedingt kennenlernen wollen.
Woraus bestehen künstliche neuronale Netze?
In den meisten Fällen handelt es sich bei den künstlichen neuronalen Netzen um ein Algorithmen-Modell, mit welchem das maschinelle Lernen überwacht oder unüberwacht stattfinden kann. Letztere werden auch als Deep Autoencoder bezeichnet. Diese Netze reduzieren eine Vielzahl an Eingabe-Dimensionen möglichst weit herunter, sodass diese den Feature-Vektor darstellen. Anschließend erfolgt eine Erweiterung der reduzierten Dimensionen und die ursprünglichen Eingabedimensionen lassen in Form eines abstrakten Modells darstellen. Der Sinn und Zweck des Ganzen besteht darin, mit Hilfe dieses Verfahrens ein abstraktes Ähnlichkeitsmodell zu erstellen. Zum Einsatz kommt dieses Verfahren vor allem, wenn ähnliche Bilder, akustische Signalmuster oder Texte maschinell erkannt werden sollen.
Um Bilddaten zu klassifizieren werden aber auch gern sogenannte Convolutional Neuronal Networks verwendet. Im Grunde handelt es sich dabei um ein klassisches neuronales Netz – mit einem kleinen Unterschied: In diesem Fall ist eine Pooling- sowie eine Faltungsschicht vorgeschaltet. Durch die Faltungsschicht werden die eingegebenen Daten mehrfach eingelesen, jedoch immer nur ein bestimmter Abschnitt. Erst dann beginnt das eigentliche neuronale Netz mit seiner Arbeit. Bei einem Convolutional Neuronal Network wird das Feature Engineering also wesentlich geschickter gehandhabt. Hierbei handelt es sich um einen ganz speziellen Aspekt des Machine Learnings.
Machine Learning – Definition
Zum Begriff Machine Learning lassen sich unterschiedliche Definitionen finden. Hier die wichtigsten Charakteristiken von KI:
- Mit dem Begriff Machine Learning bezeichnet man die Gesamtheit aller Methoden zur künstlichen Intelligenz.
- Es geht hierbei um den sogenannten Lernprozess einer Maschine, um komplexe alltägliche Aufgaben in Eigenregie zu lösen.
- Auf Grundlage der bereits gelösten Aufgaben kann sich der Lern-Algorithmus nach und nach verbessern.
- Mit dem aktualisierten Algorithmus kann die Maschine dann ein Modell erzeugen, das mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zur richtigen Lösung führt.
- Dieses Modell kann anschließend für ähnliche Fälle angewendet und gegebenenfalls ergänzt.
- Als eine Maschine kann sowohl ein bestimmter Computer, eine Anlage oder Roboter als auch eine digitale Anwendung (Software) definiert sein. Deswegen fallen auch jegliche Arten von Bots darunter, wie zum Beispiel Chat- oder Game-Bots sowie Robo-Player.
Welche Arten von Maschinellem Lernen gibt es?
Es gibt insgesamt fünf Arten des maschinellen Lernens. Für das Erstellen korrekter Lösungen wird im ersten Schritt die Art und Weise des maschinellen Lernens definiert. Hierbei unterscheidet man zwischen induktivem und deduktivem Lernen.
Beim deduktiven Lernen leitet der Computer vom Allgemeinen auf das Spezielle ab. Als Beispiel kann man einen Schwarm von Fischen nennen. Ein Computer erlernt folgende Regel: Alle Fische leben im Wasser. Nun nehmen wir einen Goldfisch. Der Computer kennt keine Goldfische. Da es sich aber um eine Fischart handelt (Bedingung), leitet der Computer daraus folgende Erkenntnis ab: Der Goldfisch muss ebenfalls im Wasser leben.
Mit dem induktiven Lernen schließt ein Computer vom Speziellen auf das Allgemeine. Aus den Erkenntnissen formuliert er dann eine Hypothese. Greifen wir hierzu wieder auf das Beispiel der Fische zurück. Der Computer weiß, dass der Goldfisch im Wasser lebt (Bedingung). Er weiß auch, dass Goldfische eine Fischart sind (Regel). Hieraus bildet der Computer folgende Hypothese: Alle Fische leben im Wasser. Aber Vorsicht! Diese Hypothese muss nicht unbedingt richtig sein. Da der Computer aufgrund von Einzelfällen auf das Allgemeine schließt, können die ersten Erkenntnisse auch falsch sein. Erst im Laufe des Lernprozesses findet der Computer dann die richtige Lösung.
Unterscheidung anhand der zur Verfügung gestellten Informationen
In der Abhängigkeit von den bereitgestellten Informationen zur Aufgabe kommen unterschiedliche Lern-Algorithmen in Betracht
- Beim überwachten Lernen (supervised learning) ist der Computer mit einer Situation konfrontiert und erhält dazu die richtige Lösung als Grundlage. Der Computer lernt nun anhand einer neuen Aufgabe, zur richtigen Lösung zu finden, indem er die Ausgangssituation und die vorgegebene Lösung als Muster heranzieht. Überwachtes Lernen wird beispielsweise bei Kategorisierungen eingesetzt, wie Bilderkennung und -zuordnung.
- Beim unüberwachten Lernen (unsupervised learning) wird der Computer ebenfalls mit einer Aufgabe konfrontiert. Er kennt allerdings nicht die Lösung, an der er sich orientieren kann. Die Maschine versucht nun, durch trial and error zum richtigen Ergebnis zu gelangen. Anschließend lassen sich die gewonnenen Erkenntnisse auf andere Anwendungen übertragen.
- Teilüberwachtes Lernen (semi-supervised learning) ist eine Mischung aus beiden vorangegangenen Techniken.
- Beim aktiven Lernen bekommt der Computer zur Ausgangssituation die Möglichkeit, die Schritte zum Lösungsweg zu erfragen. Das Ziel dieses Konzepts ist, dass die Maschine im Laufe des Lernprozesses mithilfe möglichst weniger Anfragen zum richtigen Ergebnis kommt.
- Das bestärkende Lernen (reinforcement learning) kommt dem menschlichen Lernverhalten sehr nahe. Das Modell beruht auf dem Konzept von Belohnung und Bestrafung. Die Maschine versucht im Lernprozess so vorzugehen, dass sie Belohnungen maximiert und Bestrafungen reduziert.
AI für die perfekte Zielgruppenansprache im Marketing
Unternehmer, die im Online Marketing tätig sind, werben mit passgenauer Zielgruppenansprache und performanter Werbung. Damit dies funktioniert, müssen möglichst viele Daten erhoben und mittels Datenanalyse nutzbar sein.
Hierbei spielen die Bereiche Data Science und Data Mining eine wichtige Rolle. Denn nur mit den richtigen Modellen und Verfahren lassen sich riesige Datenmengen analysieren und mithilfe von Deep Learning aussagekräftige Muster und Zusammenhänge ermitteln. In Zeiten der Informationsgesellschaft fallen immer mehr Daten an, die geschützt, verarbeitet und gespeichert werden müssen. Daher ist das Berufsbild des Data Scientist immer gefragter.
Im Online Marketing nutzt man die Erkenntnisse des maschinellen Lernens, um die Häufigkeit von Käufen zu steigern oder die Wahrscheinlichkeit für das Abspringen eines Kunden im Onlineshop zu vermindern. Hierzu bedient man sich des Predictive Analytics, also der Analyse von historischen Daten, um Werbemechanismen zu optimieren. Denn aus dem Verhalten der Kunden in der Vergangenheit lassen sich wertvolle Rückschlüsse über das künftige Kundenverhalten ziehen.
Viele Anbieter von Werbeplattformen wie Google oder Facebook arbeiten daran, dass Werbetreibende ihre Kampagnen nicht mehr manuell steuern müssen. Als Werbetreibender kann man nun mithilfe des maschinellen Lernens auf automatisierte Kampagnen zugreifen. Das Ergebnis sind performante Kampagnen, die mehr Käufe oder Leds erzielen können. Der Werbetreibende profitiert also nicht unmaßgeblich von dieser Technologie, weil das für ihn ein Umsatzwachstum bedeutet.
Personalisierte Treffer bei Search Engines und Spracherkennung
Auch im Bereich der Search Engines werden Algorithmen eingesetzt, um die User Experience (UX) zu verbessern und eine optimale loading time zu erreichen. So arbeitet das Unternehmen Google daran, möglichst relevante Suchergebnisse in seiner gleichnamigen Suchmaschine zu liefern. Auch die Search Engine Alexa von Amazon nutzt Deep Learning, um Anfragen über Spracheingabe zu erkennen und richtig zu verarbeiten. Als das gemeinsame Ziel dieser Unternehmen gilt, dass auf ihren Plattformen zukünftig nur noch personalisierte Werbung und Produkte zusehen ist. So werden Kunden nicht durch irrelevante Angebote oder Informationen verschreckt, sondern es entsteht eine dauerhafte Kundenbindung aufgrund der qualitativen Inhalte.
Detaillierte Auswertung und direkte Optimierungs-
vorschläge, komplett kostenlos und unverbindlich.
Detaillierte Auswertung und direkte Optimierungsvorschläge, komplett kostenlos und unverbindlich.
Du möchtest noch mehr Wissen?